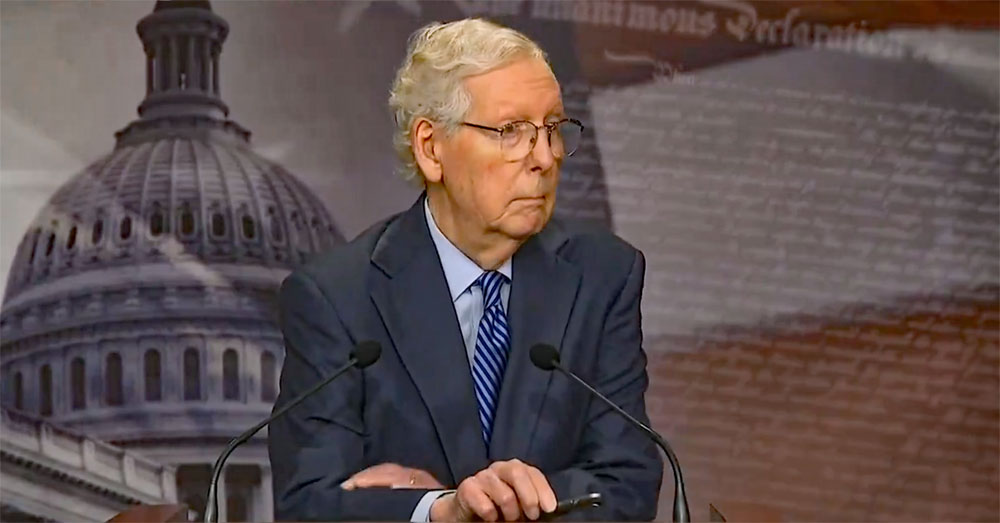Ukraine Storys: NACHT ÜBER BAKHMUT
Der Bericht und die Fotos von Francis Farrell, Journalist beim Kyiv Independent, erschienen heute. Er gibt einen Eindruck über die Lebensumstände in der umkämpften ostukrainischen Stadt Bakhmut und warum trotzdem einige Anwohner auf die Ankunft der Russen hoffen.
Farrell hatte sich, gemeinsam mit einem Journalisten aus Moldawien, Ende Januar und Anfang Februar mehrere Tage in Bakhmut aufgehalten.
Momente der Ruhe sind in der fast leeren Stadt Bakhmut rar gesät. Nicht nur das ein- und ausgehende Artilleriefeuer ist ununterbrochen zu hören, sondern auch die unterschiedliche Lautstärke und Beschaffenheit der Geräusche zeigt, wie viel Feuerkraft auf beiden Seiten in den Kampf eingebracht wird.
Zeitweise ertönt langes Gewehr- und Maschinengewehrfeuer aus den östlichen Aussenbezirken von Bakhmut. Nur zwei Kilometer vom Zentrum entfernt rücken russische Wagner-Söldner in kostspieligen, aber methodischen Angriffen in Gruppenstärke weiter auf die Stadt vor.

«KOMMEN SIE ZUM TEE»
Als wir in einen unscheinbaren Hof hinter einem Wohnhaus aus der Stalinzeit im Zentrum von Bakhmut einbiegen, finden wir Hryhorii Ostapenko genau dort, wo wir ihn drei Tage zuvor zurückgelassen hatten. Er sitzt auf einer Bank neben der Garage und hackt mit einer kleinen Axt auf zerbrochenen Fensterrahmen herum, die er zum Heizen des Holzofens in seiner Wohnung geborgen hatte.
Wir hatten die Bewohner Ostapenko, 63, und Valentyna, 59, die ihren Nachnamen aus Angst nicht nennen wollte, einige Tage zuvor bei einem Besuch in Bakhmut kennengelernt. Damals baten wir sie um Erlaubnis, mit den verbliebenen Bewohnern im Keller ihres Hauses übernachten zu dürfen.
Nach dem Austausch von Neujahrsgrüssen und der Übergabe einer Tasche mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln, die wir aus Kramatorsk mitgebracht hatten, wird unsere Unterkunft bestätigt.
«Das ist überhaupt kein Problem», sagt Ihor Selenov, ein 50-jähriger Nachbar der Beiden mit einem übermütigen Auftreten und einem Haarschnitt im Kosakenstil. «Kommen Sie doch später auf einen Tee vorbei.»
Als wir zum Auto zurückgehen, kommt ein ukrainischer Soldat hinter einem Tor hervor und ging langsam und bedächtig auf uns zu. Er hält die Arme vor seinem Gewehr verschränkt. Wir erzählen ihm von unseren Plänen, hier eine Nacht mit den übrigen Bewohnern zu verbringen.
«Sie können, wenn Sie wollen, ich würde nur nicht bei diesen Leuten bleiben», antwortete er leise und wirft uns einen verächtlichen Blick über die Schulter zu: «Die meisten von ihnen sagen offen, dass sie auf Russland warten.»
Wir bedanken uns bei dem Soldaten und machten uns auf den Weg zu anderen Orten in Bakhmut. Ich will verstehen, warum die Menschen in Ostapenkos Gebäude auf Russland warten. Auf jenes Russland, dessen Artillerie Tag und Nacht ihre Stadt in Schutt und Asche legt und sie zu einem kalten und gefährlichen Leben in Kellern zwingt.
Der Einmarsch Russlands hat die Ukraine mit überwältigender Mehrheit gegen den Aggressor geeint und die alte pro-europäische/pro-russische Kluft, die die Politik vor 2014 beherrschte und auch danach noch in geringerem Masse vorhanden war, beiseitegeschoben. Aber es gibt Ausnahmen.
WARTEN AUF DIE RUSSEN
Eine im September 2022 in der gesamten Ukraine durchgeführte Gallup-Umfrage ergab, dass nur 0,5 % der Bevölkerung der russischen Führung positiv gegenüberstehen.
So absurd es auch erscheinen mag, aber gerade in Orten wie Bakhmut, die am meisten unter dem russischen Angriff auf die Ukraine zu leiden hatten, finden sich Menschen, die zu diesen 0,5 % gehören.
In der ukrainischen Umgangssprache werden diese Menschen manchmal «zhduny» genannt, was auf Russisch «die Wartenden» bedeutet.
Nach Angaben der ukrainischen Polizei befanden sich am 2. Februar noch etwa 5’900 Zivilisten in Bakhmut, darunter über 200 Kinder. Für die älteren Generationen hier, die sich an die blühende Industrie der Region zu Sowjetzeiten erinnern und die grösstenteils für den ehemaligen Präsidenten und Kreml-Verbündeten Viktor Janukowitsch gestimmt haben, ist die Realität des monatelangen brutalen Krieges schwer zu ertragen.
Sie verfügen kaum über Informationen aus der Aussenwelt. Sie haben keine Ersparnisse oder Verbindungen, die ihnen bei einer Evakuierung helfen könnten. So verharren die verbliebenen Bewohner von Bakhmut in Untätigkeit, während die Kämpfe immer näher rücken.
Ob aus Apathie, Hoffnungslosigkeit oder aus Träumen von der erfundenen Propaganda-Idee der «russischen Welt», viele treffen die einfache, aber oft tödliche Wahl: Sie warten.
LETZTE BASTION FEUERWEHR
Wir besuchen die örtliche Feuerwache, offiziell der Hauptsitz des staatlichen ukrainischen Rettungsdienstes in Bakhmut.
Da in der Stadt sonst kaum noch etwas funktioniert, ist dieses stolze weisse Gebäude in der Nähe des zentralen Platzes einer der wenigen funktionierenden Arme des zivilen Staates in Bakhmut.
Ausgerüstet mit einem grossen Holzofen und mit wenig Licht, gespiessen von einem Generator, ist die schwach erleuchtete Haupthalle der Feuerwache ein Ort der Wärme und des relativen Komforts.
Weihnachtsbeleuchtung und eine ukrainische Flagge mit Unterschrift heben die Stimmung, während ein großer Hund, der scherzhaft nach der russischen Propagandistin Olga Skabejewa «Skabei» genannt wird, die Besucher mit Begeisterung begrüsst.

Der stellvertretende Kommandant Artur Spytsyn, 31, und seine Kollegen erledigen verschiedene Aufgaben rund um das Gebäude, während sie auf den nächsten Anruf warten.
«Unsere erste Aufgabe ist es, das Leben des Teams und der Bewohner zu schützen», sagt er, «und mittlerweile gibt es kaum noch Grund, sich um Eigentum zu kümmern. Wir überqueren den (Bakhmutka-)Fluss nicht mehr, auf der anderen Seite ist kaum noch etwas unversehrt.»
Die meisten Helfer, die noch in der Feuerwache arbeiten, sind Einheimische aus Bakhmut und den umliegenden Dörfern.
HÄUSER OHNE WASSER, STROM UND GAS
Wenn sie keine Schicht haben, kehren die Helfer in ihre Häuser zurück, die sich oft kaum von denen der anderen Bewohner unterscheiden. In den Häusern mit zerborstenen Fenstern gibt es kein Wasser, keinen Strom und kein Gas, so dass man jede Nacht zwischen dem relativen Komfort der Wohnung und der relativen Sicherheit des Kellers wählen muss.
Volodymyr Hruienko, ein 42-jähriger Fahrer eines Feuerwehrautos, führt mich um die Rückseite der Feuerwache herum zu einem Wohnhaus, das am 26. Dezember getroffen wurde. An der Stelle, an der die Granate einschlug, sind mehrere Wohnungen ausgebrannt, und nur eine Handvoll Fenster blieb unbeschädigt: Nichts Ungewöhnliches für Bakhmut.
Der russische Angriff auf das Gebiet Donezk hat Dutzende von Siedlungen durch Artillerie-, Raketen- und Panzerbeschuss praktisch zerstört.
Nach mehr als sechs Monaten an der Front reiht sich Bakhmut in die Reihe von Städten wie Wolnowacha, Popasna, Sievierodonetsk und vor allem Mariupol ein, die durch Russlands Krieg bis zur Unkenntlichkeit zerstört wurden.
AUF DER SUCHE NACH WASSER
Eine Gruppe von einem halben Dutzend Bewohnern, die meisten im Rentenalter, tummelte sich um den Eingang: einige hackten Feuerholz, andere kochen auf behelfsmäßigen Ziegelöfen, und einige stehen einfach nur schweigend herum.
Ein jüngerer Mann wendet sich an Hruienko und bittet um dringende Hilfe bei der Suche nach Wasser. Hruienko weisst ihn auf einen grossen Plastiktank hin, der etwa einen halben Kilometer entfernt hinter einem verlassenen Supermarkt steht.
«Er fasst etwa eine halbe Tonne Wasser, vier von Ihnen sollten ihn rübertragen können», sagte Hruienko. «Wenn ihr das schafft, können wir ihn für euch auffüllen.»
UNERWÜNSCHT
Die Wintersonne geht bereits über dem Hof unter, in dem Ostapenko, Selenov und Valentyna wohnen, als wir zurückkehren. Wir kommen ins Gespräch mit Valentyna und sie erzählt von ihren Kriegserfahrungen.
Vor der umfassenden Invasion lebte sie mit ihrem Sohn in Jakowliwka, einem Dorf 15 Kilometer nordöstlich von Bakhmut. Es war im Dezember von russischen Truppen eingenommen worden. Die Gegend war Schauplatz schwerer Kämpfe, die den Auftakt zum Angriff auf Soledar bildeten, der ersten Einnahme einer größeren ukrainischen Siedlung durch Russland seit Sommer 2022.
«Freunde aus meinem Dorf sagten mir unter Tränen», erinnerte sich Valentyna, «’Walja, wir würden zu unseren Ruinen zurückkehren, und sei es nur, um die Ziegel zu küssen, aber lass es unser Zuhause sein, wir wollen nur nach Hause’… aber es gibt keine Häuser mehr.»
Valentyna kam nicht direkt aus Jakowliwka nach Bakhmut, sondern verbrachte zunächst mehrere Wochen in der zentralukrainischen Stadt Kropyvnytskyi, wo sie nach eigenen Angaben mit Misstrauen behandelt wurde, weil sie aus dem Donbass stammte. «Alle sahen uns an wie Wölfe», sagte sie.
«Meine Freundin erzählte mir, wie sie, als sie zum Friseur ging und sagte, dass sie aus dem Donbass stamme, wütend hinausgeworfen wurde mit den Worten: ‹Unsere Leute sterben wegen dir, geh zurück, du kannst stattdessen getötet werden›.»
Die Diskriminierung von Menschen aus dem Donbass in der Ukraine aufgrund von sprachlichen oder politischen Vorurteilen ist ein Eckpfeiler des Propaganda-Schemas, mit dem Russland die Invasion in der Ukraine rechtfertigt.
Während die häufigen russischen Behauptungen über einen «Völkermord» an den Menschen im Donbass oder das Verbot, in der Ukraine Russisch zu sprechen, frei erfunden sind, hat der Krieg einige interne Spannungen ausgelöst.

KAUM GELD FÜR NEUANFANG
Der Fall Valentyna, die zuerst in einen sichereren Teile der Ukraine geflohen ist, um dann in ein aktives Kriegsgebiet zurückzukehren, ist kein Einzelfall.
Nach den jüngsten UN-Zahlen wurden 5,9 Millionen Menschen durch die russische Invasion innerhalb der Ukraine vertrieben. Viele dieser Menschen konnten sich in Städten in der ganzen Ukraine niederlassen und sich ein neues Leben aufbauen.
Doch mit der mageren monatlichen staatlichen Unterstützung von 54 $ pro Person und 82 $ für ein Kind oder eine Person mit einer Behinderung ist es für diejenigen, die keine Ersparnisse oder Unterstützungsnetze haben, oft unmöglich, einen Neuanfang zu machen.
«Ich habe Angst, aber jetzt habe ich das Gefühl, dass das Urteil über mein eigenes Land kommen muss», sagte sie. «Möge passieren, was immer auch geschieht, wir sind woanders sowieso nicht erwünscht.»
Schluchzend und überwältigt entschuldigt sich Valentyna höflich, nimmt das Kerzenlicht weg und wünscht uns eine gute Nacht.

«WIEVIEL ZAHLEN IHNEN DIE AMERIKANER?»
Wir zwei Journalisten sind allein im Keller und überlegen uns gerade, was wir als Nächstes tun sollten, als jemand auf der Strasse zu schreien beginnt.
«Presse! Wo seid ihr?», ruft eine männliche Stimme, gefolgt von «ratatatata!», einer schlechten Imitation eines Gewehrsalven. Es ist Selenow.
Es ist schwer zu sagen, in welcher Stimmung er sich befindet, aber wir haben keine andere Wahl, als ihm entgegenzugehen. Er zerrt seine betrunkene Frau aus einem geparkten schwarzen Geländewagen und gemeinsam gehen wir vier in seine Wohnung im zweiten Stock, um Tee zu trinken.
Auf dem Wohnzimmertisch der Familie stapeln sich zwischen Schnapsgläsern Plastikteller und -besteck, die teilweise mit Resten von Rote-Bete-Salat verziert sind.
Die Wohnung ist gemütlich, hatte aber schon bessere Tage gesehen, denn die Fenster sind kaputt und seit Monaten gibt es weder Wasser noch Strom.
Olena verlangt nach mehr zu trinken und fordert uns in provokanter Stimmung mit Schimpfwörtern auf, zu gehen. «Sagen Sie mir», fragt sie knurrend, «wie viel zahlen Ihnen die Amerikaner?»
In Olenas Weltbild muss jeder Journalist, der in ukrainisch kontrolliertem Gebiet arbeitet, auf der Gehaltsliste von Washington stehen. Peinlich berührt bringt Selenov sie ins Bett, wo sie auch bleibt.

BESOFFEN DAS KONZERT GENIESSEN
Mit einer rauen, aber liebevollen Hand streichelt Selenov eine junge Katze, während wir im Schein einer tragbaren LED-Lampe schwarzen Tee trinken. Draussen vor dem Fenster hört man Artillerie und Raketenbeschuss.
«Wenn man nüchtern ist, denkt man vielleicht, das ist das Ende», sagt er über den ständigen Beschuss seiner Stadt, «man fragt sich, wo man sich verstecken kann, aber wenn man ein paar getrunken hat, kann man sich zurücklehnen und das ‹Konzert› geniessen.»
Selenov erklärt uns seine Sicht der Dinge: «Wir sind ein Volk, wir sind alle Slawen», sagt er über Ukrainer und Russen und wiederholt damit eines der beliebtesten Narrative der russischen Propaganda. «Die USA bringen uns bei, uns gegenseitig wie Ratten zu töten, und lassen Iwanow, Petrow, Sidorow (russische Nachnamen, die auch in der Ukraine üblich sind) gegen Iwanow, Petrow und Sidorow kämpfen.»

INTERNE SPANNUNGEN
Weil Soldaten und Zivilisten bei der Intensivierung des Krieges in den Städten dicht nebeneinander leben, kommt es natürlich zu Spannungen zwischen denjenigen, die die Stadt verteidigen, und denjenigen, die zusehen müssen, wie ihre Häuser in der Schlacht zerstört werden.
«Anfangs verstanden wir uns gut mit den Soldaten», sagte Selenov, «jetzt sehen sie uns an, sprechen Russisch und fragen offen: ‹Warum sind wir tausend Kilometer gereist, um für euch zu kämpfen? Ich antworte ihnen: ‹Warum kämpft ihr für mich, warum wollt ihr meine Stadt zerstören?’»
BERICHTE ÜBER PLÜNDERUNGEN
Die Zivilbevölkerung wird immer wieder aufgefordert, die Stadt zu evakuieren, und es werden ihr auch die Mittel dazu zur Verfügung gestellt.
Diejenigen, die sich entscheiden zu bleiben, sind in einer Welt gefangen, in der Gesetze, Vertrauen und soziale Normen zusammen mit den Gebäuden selbst schnell zu bröckeln beginnen.
Selenov berichtet, dass ukrainische Soldaten versucht haben, die Wohnungen in seinem Gebäude zu plündern, weil sie dachten, sie seien verlassen. «Am Tag, nachdem sie das erste Mal kamen, wurden wir stärker getroffen als je zuvor, meine Garage wurde zerstört«, sagt er, «und dann haben sie noch einmal nachgesehen, ob wir schon weg waren. Dann brachen sie die Tür meines Nachbarn auf und begannen, nach Gold und anderen Wertgegenständen zu suchen.»
Unbestritten ist, dass in fast jedem Krieg Soldaten oft leere Wohnungen als Unterkünfte an der Front nutzen und manchmal gewaltsam einbrechen.

ZWEIFEL AN DEN SCHILDERUNGEN
Obwohl es möglich ist, dass das, was Selenov beschrieben hat, der Wahrheit entspricht, gibt es so gut wie keine dokumentierten und überprüften Fälle, in denen ukrainische Soldaten Häuser oder Geschäfte aus Profitgründen geplündert haben.
Eines der wenigsten Beispiele ist die vom Kyiv Independent angestellte Untersuchung über angebliches Fehlverhalten bei der Internationalen Legion.
Im Gegensatz dazu wurde der Vormarsch der russischen Streitkräfte in der gesamten Ukraine von massenhaften Plünderungen begleitet. Hierzu gibt es unzählige gut dokumentierte Fälle von Diebstahl von ukrainischem Eigentum, von Waschmaschinen bis hin zu ganzen Museumssammlungen.
Wir verlassen Selenovs Wohnung und kehren in den eiskalten Keller zurück, den Valentyna für uns geöffnet hatte. Doch wir stellen schnell fest, dass dies kein Ort war, um die Nacht zu verbringen. Uns bleibt nur die Möglichkeit, zur Feuerwache zurückzukehren.
STÄNDIGER BESCHUSS
Gerade als wir auf den zentralen Platz treten, zwingt uns das Geräusch der ankommenden russischen Grad-Raketen dazu, uns dicht an die Mauer zu kauern. Der Himmel leuchtet kurz orange auf, als die Raketen nicht weit hinter dem Kulturpalast einschlugen.
Wir erreichen die Feuerwache und kurz nach uns kam eine Einheit von einem Einsatz zurück. Die Besatzung war unterwegs gewesen, um einen Brand in der Nähe von Iwaniwske zu bekämpfen, einer Siedlung auf dem Weg zum kürzlich eroberten Klischtschiwka im Süden, das inzwischen zum nächsten Ziel des russischen Vormarsches geworden ist.
Berichten zufolge starb eine ältere Frau, deren Haus bis auf die Grundmauern niedergebrannt war.
ALS SEPARATIST BESCHIMPFT
Während sich die Feuerwehrleute erholen, stattet ein Mann mittleren Alters mit geschwollenem, rotem Gesicht einen unangekündigten Besuch ab. Er heisst Oleksandr, 57 Jahre alt, Mitarbeiter eines Bestattungsunternehmens.
Oleksandrs Kinder leben sicher in einem Dorf in der Nähe der Stadt Dnipro, wo sie, wie er sagt, mit Respekt und Fürsorge behandelt werden. Dennoch ist auch er traurig über die Behandlung, die er persönlich in anderen Teilen der Ukraine erfahren hat.
«Ich verstehe das nicht: Im Westen schreien sie die ganze Zeit, dass wir eine geeinte Ukraine sind,» sagte er, «aber wenn du ankommst und sagst, dass du aus dem Donbass kommst, können sie dich als Separatisten bezeichnen, ohne etwas über dich zu wissen.« Und: «Ich bin Ukrainer, wir leben alle in der Ukraine, es muss dieses menschliche Verständnis geben.» Kurz darauf geht er.
TREFFEN MIT FREIWILLIGEN
Am nächsten Morgen treffen wir vor dem Gebäude der Feuerwache zwei britische Freiwillige, die mit einem ukrainischen Priester unterwegs sindn. Ich unterhalte mich kurz mit einem von ihnen, einem sanftmütigen Mann um die Vierzig, der sich als Andrew vorstellte.
Er hatte monatelang in und um Bakhmut gearbeitet und Dutzende von Zivilisten aus einigen der gefährlichsten Frontabschnitte evakuiert.
Nur zwei Tage später kam die Nachricht, dass die britischen Freiwilligen Andrew Bagshaw, 47, und Chris Parry, 28, in Soledar vermisst werden, nachdem sie bei der Evakuierung einer älteren Frau in den russischen Angriff auf die Stadt geraten waren.
Die Fotos stimmten mit dem Gesicht des Andrew überein, den ich kurz zuvor getroffen hatte. Am 25. Januar bestätigten die Familien der beiden Männer, dass sie ums Leben gekommen sind, auch wenn die genauen Umstände ihres Todes noch unbekannt sind.
VERLUSTE UND ERFOLGE DER RUSSEN
Auf der Straße, die aus Bakhmut herausführt, sehen wir Bagger, die am westlichen Rand der Stadt neue Gräben ausheben. Das Schicksal von Bakhmut ist noch lange nicht besiegelt.
Die von Russland gemeldeten Verluste sind erschütternd: Das ukrainische Militär schätzt, dass an einem durchschnittlichen Tag der russischen Angriffe auf die Stadt etwa 150 Menschen getötet und ebenso viele verwundet wurden.
Trotz der hohen Verluste ist es Russland bisher nicht gelungen, nennenswert in das Stadtgebiet von Bakhmut vorzudringen.
Doch nördlich und südlich der Stadt ergibt sich ein für die Russen positives Bild. Die Einnahme von Soledar durch die Söldnergruppe Wagner Mitte Januar hat die nördliche Autobahn nach Bakhmut unter russische Kontrolle gebracht. Und die Einnahme von Klischtschiwka im Süden bedroht die letzte wichtige ukrainische Versorgungsroute nach Bakhmut ernsthaft.
FOTO 12: Volodymyr Hruienko

BLEIBEN – TROTZ ALLEM
Während die Kämpfe um das Gebiet des Donbass toben, zeigen Geschichten wie die von Valentyna, Oleksandr und sogar Selenov, dass ein separater, nicht weniger schwieriger Kampf um die Herzen und Köpfe der Menschen weitergeht, selbst angesichts der russischen Brutalität.
Während die meisten der Ersthelfer planen, Bakhmut zu verlassen, wenn es besetzt wird, hat Feuerwehrmann Hruienko geschworen, in seiner Heimatstadt zu bleiben:
«Ich werde nirgendwo hingehen, selbst wenn sie kommen», sagte er und rauchte in der Wintersonne eine Zigarette. «Ich bin hier geboren und ich werde bleiben. Wer wird den Menschen hier helfen, wenn wir alle weggehen? Ich werde mein Auto nehmen und den Menschen Wasser bringen… vielleicht werde ich sogar ein paar Brände bekämpfen.»
DER REPORTER
Francis Farrell ist ein Journalist von Kyiv Independent. Er arbeitete lange als freier Korrespondent und war früher in Feldmissionen der OSZE und des Europarats in Albanien und der Ukraine tätig. Farrell ist Absolvent der Universität Leiden in Den Haag und des University College London. Er war Ende Januar und Anfang Februar mit einem Journalisten aus Moldavien in der ostukrainischen Stadt Bakhmut.
Redaktionelle Anmerkung: Den Artikel von Francis Farrell habe ich redaktionell bearbeitet, das heisst übersetzt, teilweise gekürzt und mit Zwischentiteln versehen. Originalartikel: https://kyivindependent.com/national/one-night-in-bakhmut-inside-the-bleak-world-of-citys-civilians-as-russia-draws-closer
SPENDEN FÜR UNABHÄNIGKEIT
Unabhängiger Journalismus für eine unabhängige Ukraine: «Kyiv Independent» ist eine der vielen Medien in der Ukraine, die seriös über die Vorgänge im Land berichten. Doch Unabhängigkeit ist eine teure Währung. Sowohl die Ukraine als auch ihre Journalisten zahlen einen hohen Preis für den Erhalt dafür. Unterstützen Sie den vertrauenswürdigen Journalismus der Ukraine in seiner dunkelsten Stunde. Hier kann gespendet werden: https://www.patreon.com/kyivindependent